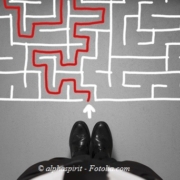Wie wirkt sich die von einem jeden Fahrzeug ausgehende Betriebsgefahr im Rahmen eines Unfalls bei sog. „Touristenfahrten“ auf dem Nürburgring aus? Diese Frage hat das Landgericht (LG) Koblenz entschieden.
Unfall bei Touristenfahrt
Die Parteien streiten um einen Schadenersatzanspruch des Klägers aus einem Verkehrsunfallereignis. Der Kläger befuhr am 2.6.2019 die Nordschleife des Nürburgrings. Im Bereich des Streckenabschnitts zwischen Schwalbenschwanz und Galgenkopf war das Krad, welches bei der Beklagten haftpflichtversichert ist, gestürzt. Zur Hilfeleistung hatte eine Dritte Person ihr KFZ zum Stand gebracht und wollte dem verunfallten Krad-Fahrer zur Hilfe eilen. Auf der Strecke lag das Krad des verunfallten Krad-Fahrers mitten auf der Straße. Vor dem klägerischen Fahrzeug fuhr zudem ein PKW BMW M4. In der Folge fuhr das klägerische Fahrzeug auf das Heck des vorausfahrenden BMW auf, wobei weitere Einzelheiten zwischen den Parteien umstritten sind. Der Kläger behauptet, dass sowohl der Grünstreifen rechts von der Fahrbahn als auch die Fahrbahn durch zwei KFZ und das Krad blockiert gewesen seien, sodass er binnen Sekundenbruchteilen und um Personenschäden zu vermeiden eine Notbremsung einleitete und mit seinem Fahrzeug gerade auf das Heck des BMW auffuhr.
Der Kläger beantragt Ersatz des ihm durch den Verkehrsunfall entstandenen Schadens und seiner Auslagen. Die Beklagte beantragt hingegen, die Klage abzuweisen.
Sie trägt vor, dass der vor dem klägerischen PKW fahrende BMW kontrolliert zum Stehen gekommen sei und der Kläger zu spät auf das Bremsmanöver des vor ihm fahrenden Fahrzeuges reagiert habe. Bei ausreichendem Abstand, angepasster Geschwindigkeit und angemessener Reaktion hätte der Kläger sein Fahrzeug ohne Weiteres unbeschadet hinter dem vorausfahrenden BMW zum Stillstand bringen können.
So entschied das Landgericht
Das LG hat der Klage nur in einem Umfang von 20 % stattgegeben, diese im Übrigen jedoch abgewiesen. Der Kläger hat gegen die Beklagte aus dem Verkehrsunfall einen Anspruch auf Schadenersatz.
Unzweifelhaft hat sich der Unfall beim Betrieb der beteiligten Kraftfahrzeuge ereignet. Ein sog. unabwendbares Ereignis könnte nicht festgestellt werden. Unabwendbar ist ein Ereignis, das durch äußerste mögliche Sorgfalt nicht abgewendet werden kann. Abzustellen ist insoweit auf das Verhalten des sogenannten „Idealfahrers“. Für das klägerische Fahrzeug ergibt sich die Vermeidbarkeit in Anbetracht der ermittelten Ausgangsgeschwindigkeit von rund 135 km/h durch einen deutlich zu geringen Abstand zum vorausfahrenden BMW, als dieser aufgrund des auf der Fahrbahn liegenden Krads voll abgebremst wurde. Aber auch dem Fahrer des bei der Beklagten versicherten Krads ist vorliegend nicht der Nachweis gelungen, dass das Unfallereignis für ihn unvermeidbar gewesen sei.
Zu geringe Abstandhaltung bei hoher Geschwindigkeit
Unstreitig ist zwischen den Parteien nämlich, dass der Fahrer mit seinem Krad gestürzt ist und das Krad in der Folge auf der Fahrbahn gelegen hat. Nach dem Straßenverkehrsgesetz (hier: § 17 Abs. 1 und Abs. 2 StVG) hängt der Umfang des zu leistenden Schadenersatzes daher von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Unfallbeteiligten verursacht worden ist. Vorliegend ist dabei zulasten des Klägers zu berücksichtigen, dass dieser unstreitig auf den vorausfahrenden BMW aufgefahren ist. Gegen den Kläger spricht dabei, dass er zu dem vorausfahrenden Fahrzeug einen zu geringen Abstand aufgewiesen hat. Demnach stand fest, dass der Kläger aufgrund eines zu geringen Abstandes zum vorausfahrenden PKW mit diesem kollidiert ist.
„Rennmodus“: Generell erhöhte Betriebsgefahr
Aufseiten der Beklagten verbleibt es allerdings bei der einzustellenden Betriebsgefahr, welche die Kammer vorliegend mit 20 % in Ansatz bringt. Nach der Rechtsprechung des OLG ist bei sog. Touristenfahrten, wie hier, bei denen bei zu zügigem (sportlichen) Fahren ein Kontrollverlust über das Fahrzeug droht, hingegen beim langsamen (vorsichtigen) Fahren die Gefahr besteht, dass es zu Auffahrunfällen mit sich von hinten „im Rennmodus“ nähernden Fahrzeugen kommt, die Betriebsgefahr eines die Nordschleife des Nürburgrings befahrenden Fahrzeugs aufgrund der gefahrenträchtigen Örtlichkeit sowie der gefahrträchtigen Verkehrssituation als generell erhöht anzusehen.
Die Betriebsgefahr des bei der Beklagten versicherten Krad hat sich auch kausal auf das Unfallereignis ausgewirkt. Das LG folgt insoweit den glaubhaften Angaben des Klägers, dass dieser eine Ausweichbewegung nach links vornehmen wollte, dies allerdings im Hinblick auf den sich auf der Strecke befindlichen Fahrer des Krads zur Vermeidung von Personenschäden unterlassen hat. Demnach hat sich hier die Betriebsgefahr des bei der Beklagten versicherten Krad kausal auf das vorliegende Verkehrsunfallereignis ausgewirkt, gleichwohl es keine direkte Berührung zwischen dem klägerischen PKW und dem bei der Beklagten versicherten Krad gegeben hat. Ausreichend ist nämlich, dass der Betrieb eines Kraftfahrzeugs zu einem schädigenden Ereignis über seine bloße Anwesenheit an der Unfallstelle hinaus durch seine Fahrweise oder sonstige Verkehrsbeeinflussung zu der Entstehung des Schadens beigetragen hat. Dies ist vorliegend der Fall und führt zu einer (anteiligen) Haftung der Beklagten in Höhe von 20 %.
Quelle: LG Koblenz, Urteil vom 16.9.2025, 5 O 123/20
Mitgeteilt von Rechtsanwaltskanzlei Herren aus 50321 Brühl